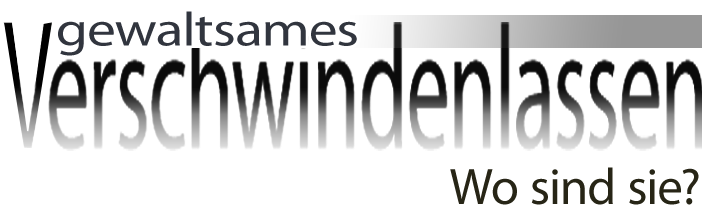In diesem Quartal erschienen einige spannende Bücher und Artikel:
Grażyna Baranowska der Universität Erlangen-Nürnberg und Milica Kolaković-Bojović des Institute of Criminological and Sociological Research in Belgrad haben gemeinsam den Sammelband „Enforced Disappearances – On Universal Responses to a Worldwide Phenomenon“ herausgebracht. Darin werden die verschiedenen Aspekte und Reaktionen der Vereinten Nationen und ihrer Gremien auf das globale Phänomen des Verschwindenlassens mit seinen lokalen Besonderheiten behandelt. Thematisiert werden zentrale Herausforderungen wie Entschädigungen, Rechte von Familien, die Beteiligung nichtstaatlicher Akteure und der Kontext von Migration. Anhand von Fallstudien aus Lateinamerika, Afrika, dem westlichen Balkan und der Asien-Pazifik-Region werden aktuelle Probleme und Herausforderungen in nationalen und regionalen Kontexten aufgezeigt. So beispielsweise in dem Artikel von unserem Kolaitionsmitglied Lene Guerke in ihrem Beitrag „Contemporary Disappearances in Mexico. A Conceptual Challenge for the International Framework on Enforced Disappearances“ die der Frage nach Handhabung gewaltsamen Verschwindenlassens durch Nicht-staatliche Akteure und dier Duldung dessen durch den mexikanischen Staat nachgeht. Rainer Huhle, ebenfalls langjäriges Mitglied der Koalition gegen das Verschwindenlassen, widmet sich zusammen mit Co-Autorin Maria Clara Galvis Patiño den Guiding Principles on the Search for Disappeared Persons und nach deren Umsetzung und Impact in verschiedenen Länderkontexten. Die Beiträge internationaler Expert*innen bieten fundierte Einblicke aus verschiedenen Rechtsordnungen. Das komplette Buch ist auch als Open Access auf Cambridge Core verfügbar.
Brigitte Herremans und Lina Ghoutouk widmen sich in dem Artikel „Presencing the Disappeared in Syria“, der im 17. Band des Journal of Human Rights Practice erschienen ist, der Frage um Aufarbeitung in Syrien. Der Artikel beleuchtet das systematische Verschwindenlassen unter dem Assad-Regime in Syrien (1971–2024) und die Folgen für Opfer und Familien: Gewalt, Unsicherheit und systematische Leugnung. Es analysiert die jahrzehntelange Blockade von Aufklärung und Verantwortung und zeigt aktuelle Herausforderungen beim Schutz von Beweisen, Massengräbern und bei der Rechenschaftslegung.
In einem Paper in Medicine, Science and the Law erörtern Dr. Anis Ahmed und Prof. Andrew Forrester die psychologischen Langzeitfolgen für Opfer gewaltsamen Verschwindenlassens. Sie und ihre Familien leiden unter einzigartigen Traumafolgen wie chronischer Angst, Depression und PTSD. Da klassische Trauertherapie hier nicht greife, fordern die Autoren evidenzbasierte, kultursensible Therapien sowie politische Maßnahmen zum Schutz der Opfer. Das ganze Paper findet sich hier.