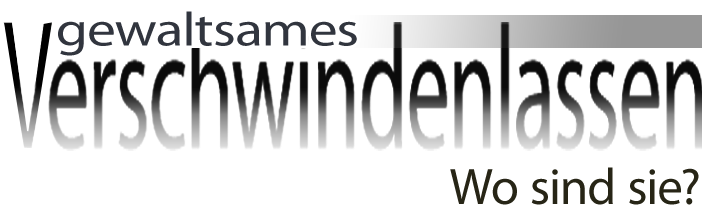Nach dem der UN-Ausschuss gegen das gewaltsame Verschwindenlassen (CED) im April erstmals in der Geschichte Artikel 34 der UN-Konvention gegen das gewaltsame Verschwindenlassen gegenüber Mexiko aktivierte (wir berichteten) hat sich einiges getan.
Im Falle der Funde der Massengräber von Teuchitlán (wir berichteten) wurden zehn Täter zu 141 Jahren Haft verurteilt. Währenddessen beschäftigt sich das Kollektiv Guerreros Buscadores de Jalisco, die den Fall von Teuchitlán augedeckt hatten, mit dem nächsten klandestinen Massengrab. In Zapopan, in der Nähe der Universität Guadalajara, stellte die Staatsanwaltschaft im Februar 169 Plastiksäcke mit Leichenteilen sicher, verhängte eine Zugangs- und Informationssperre bis alles aufgeklärt sei. Das Kollektiv der Angehörigen untersuchte dennoch Ende Juni auf eigene Initiative das Gelände und fand 78 weitere Plastiksäcke mit menschlichen Überresten. Weitere Massengräber würden ende Juli mit 32 Körpern wurde Ende Juli auf einer Finka und Mitte September mit 17 Körpern auf einer Hacienda, beide in Guanajuato, gefunden.
Derweil wurde im Juni die eine Reform des Gesetzes gegen das Verschwindenlassen im Senat verabschiedet. Verschiedene Elemente der Reform drehen sich um eine Zentralisierung von Datenbanken. Eine lange geforderte Neuerung ist, dass sie besonders bei Transgender-Personen nun auch unter ihrem gewählten Namen gesucht werden, und nicht nur unter dem amtlichen. Doch auch der Suchprozess an sich bedarf einer Einführung gendersensibler Praktiken. Welche das sein könnten, hat die mexikanische NGO I(dh)eas ausführlich zusammengestellt.
Nichtsdestotrotz kritisierten Familienverbände die Reform überwiegend, da ihre in mehreren Dialogrunden erarbeiteten Vorschläge in der Reform außen vor geblieben waren. Ende Juli gab die Secretaría de Gobernación (Innenministerium) den Aktionsplan zur Umsetzung der Reform bekannt. Im September wurde außerdem Martha Lidia Pérez Gumercindo als neue Vorsitzende der Nationalen Suchkommission ernannt. Sie hatte zuvor bei der Sonderstaatsanwaltschaft zu gewaltsamem Verschwindenlassen auf Bundesebene und im Bundesstaat Veracruz gearbeitet.
Unterdessen haben die NGOs Reporters Sans Frontières (RSF) und Propuesta Cívica Ende August zwei neue Beschwerden beim UN-Menschenrechtsausschuss eingereicht. Sie betreffen das gewaltsame Verschwindenlassen der zwei Journalist*innen María Esther Aguilar Cansimbe (2009) und José Antonio García Apac (2006) aus dem Bundesstaat Michoacán. Im Fall des am 19. Juni 2025 verschwundenen José Juan Arias Solís hat der CED Mexiko zu Dringlichkeitsmaßnahmen zur Suche und Schutz der Angehörigen verpflichtet. Der 14-jährige war bei einer Sicherheitsoperation der Guardia Nacional verschwunden.
Im Zuge des Internationalen Tages gegen das Verschwindenlassen wurden mehrere interessante Reportagen besonders über einzelne suchende Mütter in Mexiko veröffentlicht. Hier eine kleine Auswahl: BBC News Mundo über Yadira González, die ihren seit 2006 verschwundenen Bruder Juan González sucht und über die Rolle der organisierten Kriminalität berichtet; Die Plattform A dónde van los desaparecidos über Estea Santos, die ihren seit 2024 in Palenque verschwundenen Sohn Brayan Fernando Mesa Santos sucht, der offenbar zwangsrekrutiert wurde. Amnesty International veröffentliche zwei Berichte über die Rolle der suchenden Familienangehörigen. Die Deutsche Menschenrechtskoordination Mexiko brachte außerdem ein aktualisiertes Factsheet zu Gewaltsamem Verschwindenlassen in Mexiko auf mehreren Sprachen heraus, das besonders bei Advocacy Arbeit sehr hilfreich sein kein. Vom Ökumenischen Büro München gibt es ein spannendes Podcast zum Thema mit Bezug auf Mexiko und El Salvador.
Im Kontext des elften Jahrestages des Verschwindenlassens der 43 Studenten aus Ayotzinapa gaben die Familien eine gemeinsame Erklärung ab, diese findet sich hier. Carlos Beristain gab diesbezüglich ein interessantes Resumee aus der Perspektive als ehemaliges Mitglied der GIEI und mit Blick auf die aktuellen Schwierigkeiten.