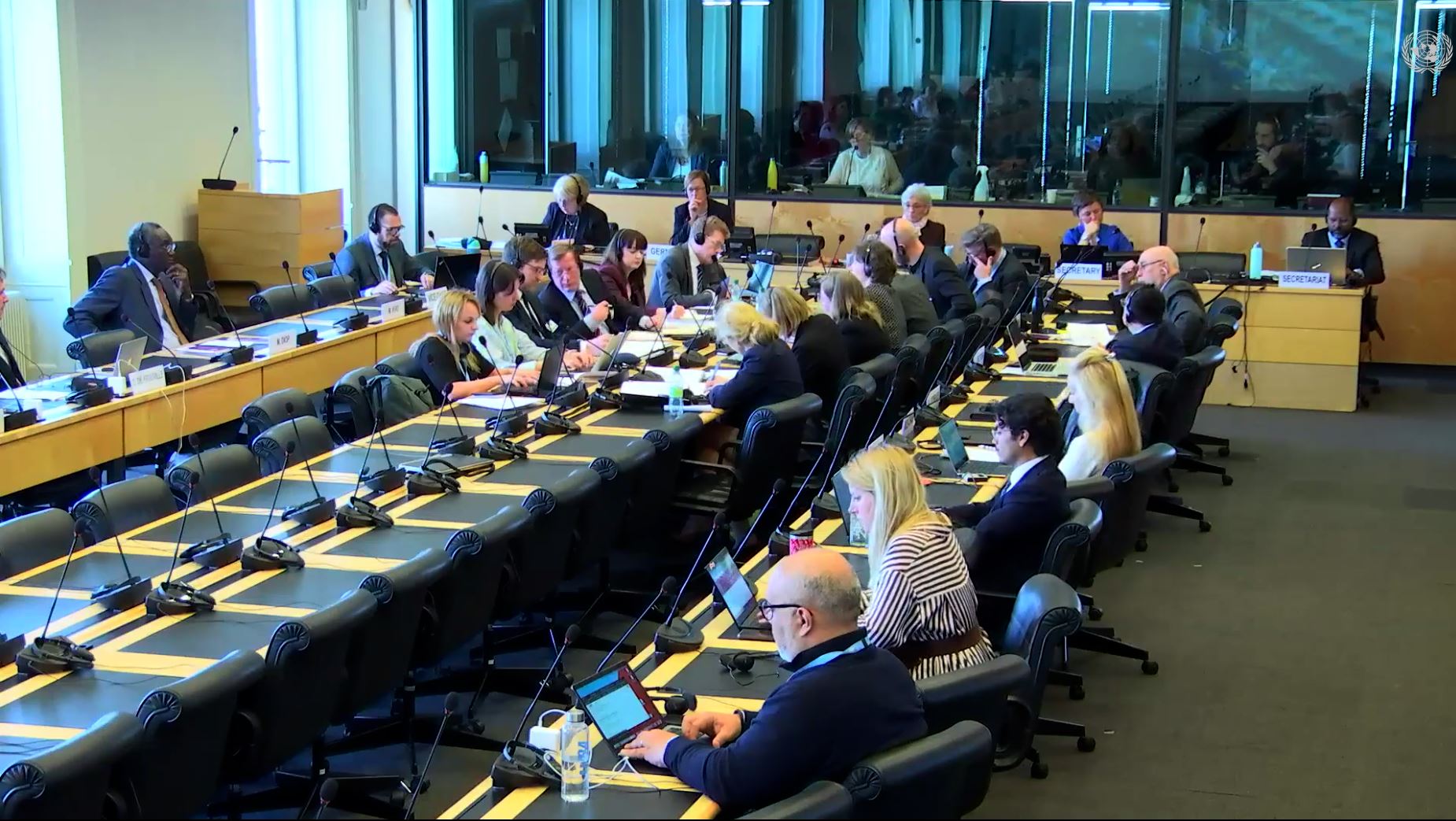von Silke Voß-Kyeck 11. Mai 2023
Vor einigen Wochen traf ich Ana Lorena Delgadillo, Gründerin und Leiterin der Menschenrechtsorganisation FJEDD (Stiftung Gerechtigkeit und demokratischer Rechtsstaat), am Rande einer Veranstaltung, auf der sie über ihr langjähriges Engagement gegen das gewaltsame Verschwindenlassen in Mexiko berichtete. Die folgenden Tage würde sie auch im Auswärtigen Amt und im Bundestag um Unterstützung ihrer Arbeit gegenüber der mexikanischen Regierung werben. Sie war einigermaßen fassungslos als ich ihr erzählte, dass Deutschland zwar die Internationale Konvention gegen das Verschwindenlassen schon 2009 ratifiziert, ein zentrales Element – dieses Verbrechen als solches strafbar zu machen – aber bis heute nicht umgesetzt hat. Ich fragte sie also, mit welchem Argument sie ihre Gesprächspartner davon überzeugen wolle, und sie antwortete, „weil sie die Konvention ratifiziert haben natürlich.“
So einfach ist das. Wenn eine Regierung eine völkerrechtliche Verpflichtung eingegangen ist, muss sie diese auch in absehbarer Zeit erfüllen. Für das Bundesjustizministerium scheint es andersherum einfach zu sein: das Strafgesetzbuch habe doch Tatbestände, mit denen Fälle von Verschwindenlassen geahndet werden können. Einen eigenen Straftatbestand zu schaffen wäre hingegen furchtbar kompliziert und schwer in die bestehende Strafrechtsordnung einzupassen.
Den Ausschuss gegen das Verschwindenlassen konnte die deutsche Delegation mit dieser Haltung ganz und gar nicht überzeugen, als sie am 22. März 2023 in Genf Bericht erstatten musste, wie die Konvention hierzulande umgesetzt wird. Bereits 2014, bei der ersten Überprüfung, kritisierte der Ausschuss, dass Deutschland noch keinen eigenen Straftatbestand eingeführt hatte. Wer nun erwartet hatte, dass die Bundesregierung über 12 Jahre nach Inkrafttreten der Konvention Vollzug oder wenigstens Fortschritte melden würde, wurde enttäuscht. Olivier de Frouville, einer der Berichterstatter im Ausschuss, machte aus seiner Ratlosigkeit keinen Hehl: Wie kann es sein, dass Deutschland sich einerseits an vorderster Front gegen die Straflosigkeit schwerer Menschenrechtsverletzungen engagiert und andererseits so vehement Widerstand leistet bei der Umsetzung dieses Übereinkommens in nationales Recht?
Erklären konnte die Delegation unter Leitung des federführenden Justizministeriums (BMJ) dies in Genf nicht. Die Delegation argumentierte juristisch äußerst konservativ, konnte manche Widersprüche nicht auflösen und musste teilweise irreführende Aussagen korrigieren. Es wurde sogar in Frage gestellt, dass sich aus der Konvention überhaupt eine Verpflichtung für einen eigenen Straftatbestand ableiten lässt, was bei den Ausschussmitgliedern unübersehbare Irritationen auslöste. Laut Artikel 4 der Konvention muss jeder Vertragsstaat „sicherstellen, dass das gewaltsame Verschwindenlassen nach seinem Strafrecht eine Straftat darstellt“, und der Ausschuss hat von Beginn seines Bestehens an klargestellt, dass dies einen Tatbestand entsprechend der Definition in Artikel 2 der Konvention verlangt.
Das BMJ vertritt schon seit der Ratifizierung die Auffassung, dass Tatbestände wie z.B. Freiheitsberaubung, Geiselnahme oder erpresserischer Menschenraub ausreichen, um Fälle von Verschwindenlassen angemessen aufzuklären und zu ahnden. Dies verkennt jedoch, dass es sich beim gewaltsamen Verschwindenlassen einer Person nicht um keine Aneinanderreihung oder Kombination verschiedener Straftaten handelt, sondern um ein einziges, mehrdimensionales Verbrechen, das auch entsprechende Strafdrohungen und Verjährungsfristen verlangt. Der Ausschuss ließ keinen Zweifel, dass die angeführten Einzelstraftatbestände und Rechtsnormen dem spezifischen Unrechtsgehalt des gewaltsamen Verschwindenlassens und den Vorgaben der Konvention nicht gerecht würden.
Der Fall des Vietnamesen Trinh Xuan Thanh, der 2017 aus Berlin „entführt“ wurde und erst nach Tagen inhaftiert in Vietnam wieder auftauchte, ist beispielhaft für das Problem: Einer der Tatbeteiligten hatte im Rahmen einer vietnamesischen Geheimdienstoperation das Opfer im Auto nach Bratislava gefahren und wurde im Januar 2023 zu einer fünfjährigen Freiheitsstrafe u.a. wegen Beihilfe zur Freiheitsberaubung und geheimdienstlicher Agententätigkeit verurteilt. Obwohl hier höchstwahrscheinlich ein Fall von gewaltsamem Verschwindenlassen vorlag, konnte der Täter dafür nicht angeklagt und auch nur als Teilnehmer statt als Täter verurteilt werden, weil ein solcher Straftatbestand im StGB eben nicht existiert. Sollte ein Verbrechen nicht als das bezeichnet und bestraft werden, was es tatsächlich ist?
Besonders widersprüchlich war die Argumentation der Bundesregierung in Bezug auf das sogenannte „Al-Khatib-Verfahren“ vor dem Koblenzer Oberlandesgericht gegen zwei Angehörige des syrischen Geheimdienstes. In der schriftlichen Stellungnahme hatte das BMJ 2020 erklärt, der Prozess hätte gezeigt, dass mit dem Völkerstrafgesetzbuch (VStGB) Täter des Verschwindenlassens (im Rahmen eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit) in Deutschland wirksam bestraft werden könnten. Dieser Tatbestand war jedoch in der Anklageschrift der Generalstaatsanwaltschaft nicht einmal erwähnt worden.
Grund dafür war, dass das gewaltsame Verschwindenlassen im VStGB enger definiert ist als in Artikel 2 der Verschwindenlassen-Konvention und zusätzliche Anforderungen enthält, welche die Realitäten dieses Verbrechens zu Lasten der Opfer missachten. So müsste die Anklage etwa nachweisen, dass bei den Behörden nach dem Verbleib der verschwundenen Person gefragt worden ist. Man braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, wie gefährlich das in Syrien und anderen Diktaturen sein kann. Der Vertreter der Bundesanwaltschaft erklärte schließlich entgegen der schriftlichen Stellungnahme sogar, selbst wenn man die Definition nach Artikel 2 der Konvention herangezogen hätte, wäre eine Anklage nicht möglich gewesen. Der Ausschuss zeigte sich besorgt über diese Auslegung und forderte Deutschland auf, das VStGB unverzüglich in Übereinstimmung mit den Vorgaben der Konvention zu bringen.
Während es in Bezug auf das VStGB Bewegung gibt, ist ein politischer Wille für die Umsetzung der Verschwindenlassen-Konvention im StGB leider noch nicht zu erkennen. Da half es der Delegation auch nicht, auf ihren Austausch mit der Zivilgesellschaft zu verweisen, denn auf Nachfrage musste eingeräumt werden, dass ein solcher Austausch zuletzt 2014 stattgefunden hatte. Suela Janina, ebenfalls Berichterstatterin für Deutschland, konnte ihre Empörung darüber nicht verbergen, dass Deutschland es in 13 Jahren seit der Ratifizierung nicht geschafft hat, mit einem eigenen Straftatbestand im StGB die Verpflichtungen aus Artikel 4 umfassend zu erfüllen. Warum gibt es immer noch Lücken im deutschen Strafrecht, die möglicherweise verhindern, dass Täter des Verschwindenlassens dafür bestraft werden?
Das in Artikel 24 der Konvention verbriefte Recht auf Wahrheit für die Opfer des Verschwindenlassens umfasst – und setzt voraus – die schwere, komplexe Menschenrechtsverletzung des Verschwindenlassens auch als solche zu benennen und nicht als Freiheitsberaubung oder Entführung „kleinzureden“. Dies gilt für eine einzelne Tat ebenso wie die ausgedehnte und systematische Praxis, die zum Verbrechen gegen die Menschlichkeit wird. Eine entsprechende Gesetzgebung als rein symbolischen Akt darzustellen, wird den Opfern nicht gerecht und auch nicht der Vorbildfunktion, die Deutschland für sich in Anspruch nimmt. Die vollständige Umsetzung der Verpflichtungen aus internationalen Menschenrechtsverträgen ist mehr als nur von symbolischem Wert.